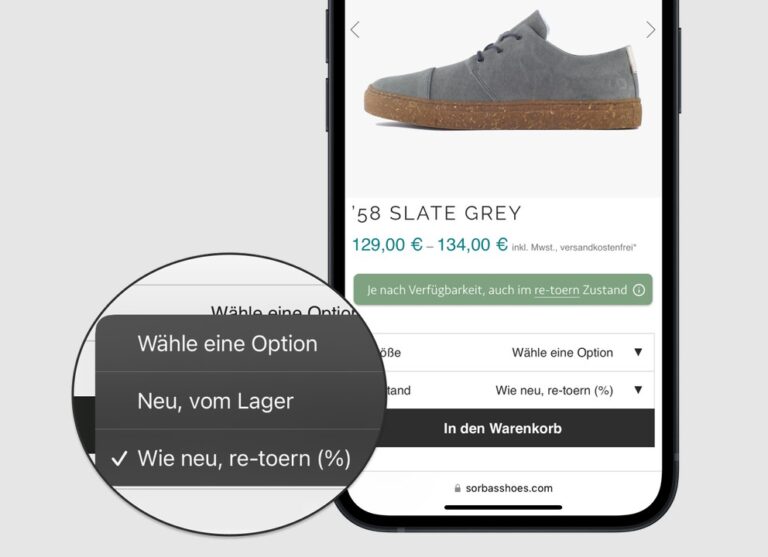Das EU-Lieferkettengesetz, ein aktuelles und kontrovers diskutiertes Thema, bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen für den Einzelhandel und die Wirtschaft im Allgemeinen mit sich.
1. Hintergrund und Zielsetzung des EU-Lieferkettengesetzes
Das Europäische Lieferkettengesetz zielt darauf ab, Unternehmen für die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltschutz entlang ihrer Wertschöpfungsketten verantwortlich zu machen. Dieses Gesetz soll strengere Regelungen als das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) einführen, mit einem erweiterten Anwendungsbereich, der Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 150 Millionen Euro umfasst. Für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 40 Millionen Euro, die mehr als die Hälfte ihres Umsatzes in „Risikobereichen“ wie der Textilindustrie erzielen, greifen bestimmte Sorgfaltspflichten sogar schon ab 250 Mitarbeitern.
2. Aktueller Stand und zukünftige Erwartungen
Obwohl der Richtlinienvorschlag derzeit keine unmittelbaren Auswirkungen auf deutsche Unternehmen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Richtlinie in nicht allzu ferner Zukunft in Kraft treten wird. Dies würde bedeuten, dass der deutsche Gesetzgeber das LkSG nachschärfen müsste. Der Vorschlag enthält unter anderem eine zivilrechtliche Haftungsklausel, die es geschädigten Personen ermöglicht, europäische Unternehmen für Missstände in der Lieferkette zu verklagen.
3. Herausforderungen für Unternehmen
Ein Schlüsselelement des Gesetzes ist die Verpflichtung von EU-Unternehmen, nur noch Lieferanten oder Vertriebspartner zu nutzen, die die von der EU geforderten sozialen und grünen Mindeststandards erfüllen. Dies könnte zu erheblichen Mehrbelastungen führen, insbesondere durch die Kosten für ein umfangreiches Berichtswesen und den etwaigen Umbau ihrer Lieferketten.
4. Mögliche negative Auswirkungen
Einige Experten argumentieren, dass das Lieferkettengesetz dazu führen könnte, dass EU-Unternehmen die Verbindungen zu Ländern mit schwierigen Bedingungen kappen und sich stattdessen auf „sichere“ Länder konzentrieren, was das Gegenteil des beabsichtigten Effekts haben könnte. Anstatt die Standards in Entwicklungsländern zu verbessern, könnten die Unternehmen die Risiken minimieren wollen, was zu einer Konzentration auf weniger, aber größere Zulieferer führt.
5. Detaillierte Anforderungen des EU-Lieferkettengesetzes
Das EU-Lieferkettengesetz stellt spezifische Anforderungen an Unternehmen, je nach ihrer Größe und ihrem Umsatz. Für größere Unternehmen (über 500 Mitarbeiter, mehr als 150 Millionen Euro Umsatz) gelten strengere Vorgaben als für kleinere. Diese Vorgaben umfassen die Überprüfung und Berichterstattung über die gesamte Lieferkette, die Einrichtung von Beschwerdemechanismen und die Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung für die Einhaltung dieser Pflichten.
6. Verantwortlichkeiten und Haftungen
Unternehmensführer müssen nicht nur die Sorgfaltspflichten einführen und beaufsichtigen, sondern auch die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf Nachhaltigkeit und Menschenrechte berücksichtigen. Zudem müssen sie einen Übergangsplan erstellen, der zeigt, wie das Unternehmen den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und die Ziele zur Emissionsreduktion anstrebt. Unternehmen haften für Schäden, die durch Verstöße gegen diese Sorgfaltspflichten entstehen, es sei denn, es handelt sich um Aktivitäten indirekter Geschäftspartner, bei denen der Nachweis ernsthafter Bemühungen zur Schadensvermeidung ausreicht.
7. Sanktionen
Mitgliedstaaten bestimmen die Sanktionen, die sich am Umsatz des Unternehmens orientieren sollen und sowohl wirksam als auch abschreckend sein müssen. Bei Verstößen gegen die Vorgaben des Gesetzes können Unternehmen sanktioniert werden, wobei das Bemühen des Unternehmens bei der Bemessung der Sanktion berücksichtigt wird.
8. Kritik
Angesichts der komplexen globalen Wirtschaftslage, einschließlich der Folgen der Pandemie, Inflation, und des Wettbewerbs mit Ländern wie China, wird argumentiert, dass das Lieferkettengesetz zusätzliche Belastungen für europäische Unternehmen darstellt, die möglicherweise nicht im besten Interesse der Wirtschaft sind. Es wird vorgeschlagen, das Vorhaben möglicherweise für einige Jahre auf Eis zu legen oder zumindest anzupassen. Es wird andernfalls befürchtet, dass die umfassenden Überwachungs- und Berichtspflichten sowie die potenzielle Haftung für Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten eine erhebliche finanzielle und organisatorische Last darstellen, insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen.
Ein Hauptkritikpunkt am EU-Lieferkettengesetz ist seine potenziell übermäßige Belastung für Unternehmen, besonders in der aktuellen wirtschaftlichen Lage. Um dies zu adressieren, könnten folgende Änderungen vorgenommen werden:
- Flexiblere Umsetzungsfristen: Unternehmen könnten mehr Zeit eingeräumt werden, um die neuen Anforderungen schrittweise umzusetzen, besonders unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen.
- Unterstützung für KMUs: Kleinere Unternehmen könnten spezielle Unterstützungsmaßnahmen erhalten, um die zusätzlichen Kosten und administrativen Belastungen zu bewältigen. Dazu könnten finanzielle Hilfen oder Beratungsangebote gehören.
- Differenzierte Regulierung: Anstatt einer „Einheitslösung“ könnte das Gesetz differenziertere Vorschriften anbieten, die die spezifischen Herausforderungen und Risiken verschiedener Branchen und Unternehmensgrößen berücksichtigen.
- Stärkere Fokussierung auf Kooperation und Entwicklung: Anstatt strikter Haftungsregeln könnte das Gesetz mehr Wert auf die Förderung von Kooperationen zwischen Unternehmen und Zulieferern in Entwicklungs- und Schwellenländern legen, um gemeinsam Standards zu verbessern.
Diese Änderungen könnten dazu beitragen, die Effektivität des Gesetzes zu steigern, ohne die Unternehmen übermäßig zu belasten.