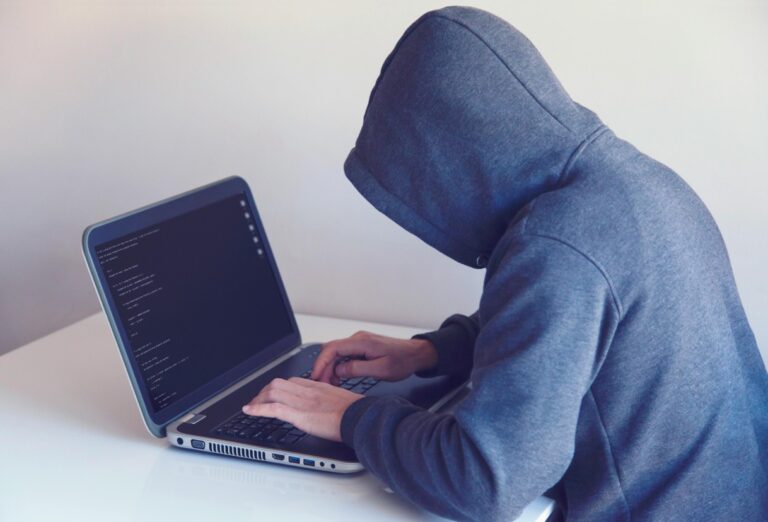Seit Jahrzehnten bildete eine von den USA dominierte, regelbasierte Weltwirtschaftsordnung unter dem Dach der WTO das Fundament globalen Handels. Diese Ordnung ist ins Wanken geraten – und das mit spürbaren Konsequenzen für stark exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland. Eine aktuelle Studie der Prognos AG im Auftrag der vbw beschreibt eine Zeitenwende mit konkreten Handlungserfordernissen.
USA und China als Unsicherheitsfaktoren
Besonders prägend für den Wandel ist die zunehmende Machtkonkurrenz zwischen den USA und China. Beide Länder – Deutschlands wichtigste Handelspartner – entfernen sich zunehmend vom Prinzip des freien Handels. Die USA verfolgen unter Präsident Trump eine dezidiert protektionistische Agenda, China kombiniert wirtschaftliche Abschottung mit globalem Machtanspruch. Für deutsche Unternehmen bedeutet das: Weniger Planungssicherheit, höhere Handelshemmnisse und eine zunehmende Fragmentierung globaler Lieferketten.
Gewinnen in der Plattform-Ökonomie
Drei Szenarien für die Weltwirtschaft
Die Studie entwirft drei mögliche Zukunftsszenarien: Im ersten Szenario („Offene EU“) gelingt es Europa, sich als neutraler Partner neu auszurichten, neue Handelsabkommen zu schließen und den Binnenmarkt zu stärken. Im zweiten („Protektionistische EU“) reagiert die EU mit Abschottung und verliert weiter an außenwirtschaftlicher Dynamik. Im dritten („Geopolitische Eskalation“) eskaliert der Konflikt zwischen USA und China militärisch, mit massiven wirtschaftlichen Verwerfungen auch für Deutschland.
Gefahren für Export, Investitionen und Forschung
Deutschland ist besonders betroffen, weil ihre Volkswirtschaften stark vom Außenhandel abhängen. Laut Prognos hat die Globalisierung bis 2018 ein Fünftel des deutschen Wirtschaftswachstums beigesteuert. Ein Rückgang des Handels mit den USA und China um die Hälfte würde alleine in Bayern zu einem Rückgang des Außenhandelsvolumens von rund zehn Prozent führen. Besonders betroffen wären Branchen wie die Pharmaindustrie, der Maschinenbau und die Elektroindustrie. Auch Auslandsinvestitionen und internationale Forschungspartnerschaften geraten unter Druck.
Handlungsoptionen für Europa
Zentrale Empfehlung der Studie ist eine strategische Neuausrichtung der EU-Außenwirtschaftspolitik. Dazu gehören pragmatischere und zahlreichere Freihandelsabkommen, eine konsequente Vertiefung des Binnenmarktes – insbesondere im Dienstleistungsbereich – und die Diversifizierung der globalen Wirtschaftsbeziehungen. Länder wie Indien, die ASEAN-Staaten oder auch Kanada und Australien gewinnen als Partner an Bedeutung. Ein solcher Kurs könne die drohenden Verluste durch die wirtschaftliche Entkopplung von den USA und China zumindest abfedern.
Fazit: Europa hat Gestaltungsmacht – wenn es sie nutzt
Auch wenn eine Rückkehr zur alten Weltordnung unrealistisch erscheint, bietet die Transformation Chancen. Die EU muss sich wirtschaftlich breiter aufstellen und geopolitisch unabhängiger agieren. Die Studie zeigt, dass Europa trotz geopolitischer Begrenzungen die Möglichkeit hat, eine neue, widerstandsfähigere Handelsstrategie zu entwickeln – zum Nutzen seiner Unternehmen und Standorte, besonders in Bayern und Deutschland.
Kurzfristig Experten benötigt? Hier die passenden Freelancer auf Fiverr