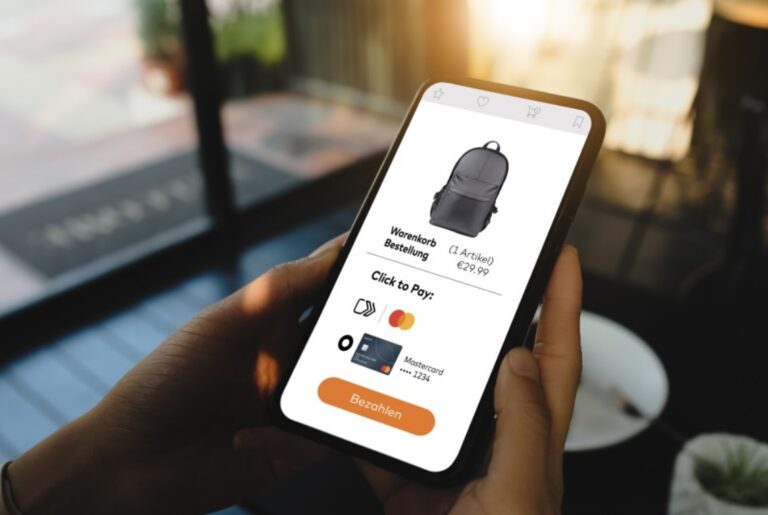Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur EU-Mindestlohnrichtlinie vom 11. November 2025 könnte weitreichende Folgen für die Lohnpolitik in Europa haben – insbesondere für Deutschland. Hintergrund ist die Klage Dänemarks, unterstützt von Schweden, gegen die 2022 verabschiedete Richtlinie über angemessene Mindestlöhne. Die Richter gaben Dänemark nun teilweise recht: Zwei zentrale Bestimmungen der Richtlinie wurden für nichtig erklärt.
EU überschritt Kompetenzen bei Mindestlohnvorgaben
Konkret bemängelte der EuGH, dass die EU mit den Vorgaben zur Festlegung und Aktualisierung von Mindestlöhnen in die nationale Zuständigkeit eingegriffen habe. Auch die Regel, wonach Löhne mit automatischer Indexierung nicht gesenkt werden dürfen, wurde gekippt. Der Gerichtshof begründete das Urteil damit, dass die Höhe der Löhne allein Sache der Mitgliedstaaten sei. Zwar darf die EU laut Vertrag über die Arbeitsweise der Union Regelungen zu Arbeitsbedingungen treffen, nicht jedoch zur konkreten Höhe des Entgelts.
Trotz der gestrichenen Passagen bleibt der Großteil der Richtlinie in Kraft. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Tarifbindungen zu stärken, besteht weiterhin.
Gewinnen in der Plattform-Ökonomie
Kommission begrüßt das Urteil – trotz Abstriche
Die EU-Kommission bewertet das Urteil insgesamt positiv. Sie begrüßt, dass die Richtlinie in ihrer Gesamtheit weitgehend bestätigt wurde. Präsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete das Urteil als „Meilenstein für Europas Arbeitnehmer“ und betonte die Bedeutung von fairer Entlohnung und tariflicher Autonomie. Auch Vizepräsidentin Roxana Mînzatu unterstrich, dass das Urteil das europäische Sozialmodell stärke.
Allerdings nimmt die Kommission auch die Entscheidung zur Kenntnis, Teile der Richtlinie für nichtig zu erklären, und kündigte an, deren Auswirkungen nun genau zu analysieren. Die Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht wird laut Kommission dadurch nicht beeinträchtigt.