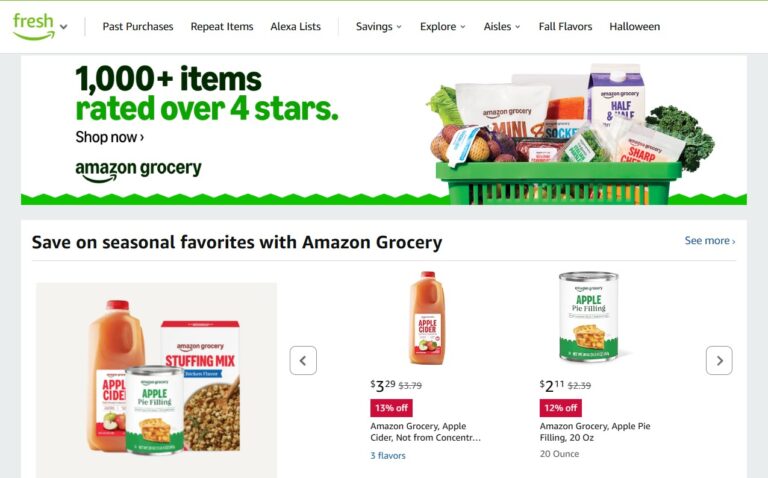Die Digitalisierung von Verwaltungs-, Wirtschafts- und Alltagsprozessen verlangt zunehmend eine verlässliche digitale Identität. Während in vielen EU-Staaten nationale eID-Lösungen bestehen (z. B. Deutschland, Estland, Spanien), fehlt laut Europäische Union bislang ein gemeinsamer, paneuropäischer Standard, der national verankerte IDs über Grenzen hinweg interoperabel macht. Genau das will die EU mit dem neuen Rahmenwerk für eine EU Digital Identity (eID / EUDI Wallet) ändern.
Historische Einordnung: eIDAS & nationale eID-Systeme
Der rechtliche Ausgangspunkt ist die Verordnung (EU) Nr. 910/2014, bekannt als eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services). Diese Regelung etablierte erstmals verbindliche europäische Normen für elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste wie elektronische Signaturen, Zeitstempel oder Siegel. Kernprinzip war die gegenseitige Anerkennung (Mutual Recognition) von nationalen eID-Systemen: Wenn ein Mitgliedstaat ein eID-System meldet („notifies“) und die technischen Anforderungen erfüllt, müssen andere Staaten es im Rahmen von Online-Verfahren akzeptieren.
Über die Jahre bildete sich ein Flickenteppich heraus: Manche Staaten führten leistungsfähige eID-Karten oder Apps, andere eher rudimentäre Systeme oder gar keine. Die eIDAS-Verordnung war hilfreich, aber nicht ausreichend, um europäische Einheitlichkeit und Nutzerfreundlichkeit zu garantieren.
Im Juni 2021 legte die Europäische Kommission daher den Vorschlag für eine neue Verordnung vor – eine Art „eIDAS 2.0“ mit Fokus auf digitale Wallets und mehr Kontrolle durch die Nutzer.
Gewinnen in der Plattform-Ökonomie
Neuer Rahmen: European Digital Identity Regulation (2024/1183) & der EUDI Wallet
Im Mai 2024 trat die neue Verordnung in Kraft, die den bisherigen eIDAS-Rahmen erweitert. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, bis Ende 2026 mindestens eine digitale Identitäts-Wallet (EU Digital Identity Wallet, kurz: EUDI Wallet) anzubieten – für alle Bürger, Einwohner und Unternehmen.
Die Wallet soll dabei freiwillig sein – niemand wird gezwungen, sie zu benutzen. Zudem wird ein Set von Implementing Acts (Durchführungsverordnungen) entwickelt, die technische Spezifikationen, Attribute, Vertrauensrahmen und Interoperabilität regeln. Im Juli 2025 wurden neue Implementing Acts veröffentlicht, die in 20 Tagen in Kraft treten.
Diese Regelungen definieren, welche Attribute (z. B. Name, Geburtsdatum, Führerschein, Diplome) in der Wallet geführt werden können, wie identitätsbezogene Vertrauensdienste zertifiziert werden und wie die Wallet gegenüber Diensten und Behörden kommuniziert. Die eID-Komponente ergänzt bestehende nationale Systeme, statt sie zu ersetzen.
Ziele & Use Cases: Was soll die EU-eID leisten?
Der EU-Rahmen verfolgt mehrere Zielsetzungen:
- Interoperabilität im Binnenmarkt: Bürger sollen mit ihrer digitalen Identität Dienste in jedem EU-Mitgliedstaat nutzen können, ohne auf nationale Hürden zu stoßen.
- Datensouveränität und Kontrolle: Die Nutzer sollen selbst entscheiden, welche Daten sie teilen – und Dienste sollen nur die minimal notwendigen Informationen abfragen.
- Sicherheit & Vertrauen: Die Wallet soll hohe Sicherheitsstandards, zertifizierte Vertrauensdienste und klare Auditierbarkeit bieten.
- Vereinfachung von Verwaltungsprozessen & digitalen Diensten: Von der Beantragung eines Dokuments über Firmengründungen bis hin zur Nutzung privater Dienste (z. B. Online-Banking, Versicherungen) – viele Use Cases profitieren von zuverlässiger digitaler Identität.
- Grenzüberschreitende Dienstleistungen: Studieren, Arbeiten, Wohnen in einem anderen EU-Staat wird einfacher, da Identitätsnachweise digital und anerkannt sind.
Konkrete Use Cases:
- Speicherung und Vorlage von Ausweisdokumenten, Diplomen, Führerscheinen
- Elektronische Unterschrift / Siegel bei Verträgen
- Identitätsnachweise bei privaten Diensten wie Banken, Mobilfunkanbietern oder Versicherungen
- Verwaltung von persönlichen Attributen (z. B. Altersnachweis, Wohnsitz)
- Authentifizierung bei staatlichen Online-Diensten (z. B. Steuerportal, Sozialversicherungsdienste)
Technische und architektonische Aspekte
Die technische Architektur basiert auf einem Reference Framework / Referenzmodell, das von der EU-Kommission bereitgestellt wird. Die Wallets sollen interoperabel sein, d. h. unterschiedliche nationale Implementationen müssen ein gemeinsames Protokoll verwenden, um miteinander zu kommunizieren.
Die Architektur berücksichtigt auch Vertrauensdienste (Trust Service Providers, TSPs), die elektronische Signaturen, Zeitstempel, Siegel oder Attribute validieren. Diese Dienste müssen qualifiziert sein und zertifiziert werden gemäß eIDAS-Standards.
Datenschutz und minimale Datennutzung („Data Minimization“) sind zentrale Designprinzipien. Der Nutzer entscheidet explizit, welche Attribute er teilen will – idealerweise über selektive Offenlegung (Selective Disclosure).
Ein weiteres wichtiges technisches Feature: Self-Sovereign Identity (SSI)-Konzepte oder dezentrale Identitätsmodelle spielen eine Rolle bei Diskussionen, wie Wallets gestaltet werden können, insbesondere in Bezug auf Offline-Funktionalität und kryptografische Beweissysteme.
Ein Zusatz: Die EU arbeitet daran, den EUDI Wallet Standard auch international kompatibel zu machen, etwa mit Nachbarstaaten oder Partnerregionen.
Aktueller Stand & Pilotprojekte
Seit April 2023 laufen vier Large Scale Pilots, in denen Wallet-Prototypen in mehreren Mitgliedstaaten getestet werden. Mehr als 350 öffentliche und private Akteure (Behörden, Unternehmen, Dienstleister) sind beteiligt. Die Piloten decken Use Cases wie Identifizierung, Verwaltung von Dokumenten, Zahlungen oder Bildungsnachweise ab.
Im Sommer 2025 wurden neue Implementing Acts verabschiedet, insbesondere zum Attribut-Vertrauensrahmen (Trust Framework) und zur Attribute Attestation (technische Spezifikationen zur Validierung von Attributen).
Auch im Bereich Zahlung gibt es Bewegung: Der niederländische Zahlungsverband (Dutch Payments Association) prüft, wie sich die EU-eID auf Zahlungsprozesse auswirkt und welche Ambiguitäten Zahlungsdienstleister beachten müssen.
Ein weiteres Indiz für die Ambitionen: Die EU will, dass die Digital Identity Wallet auch international anerkannt wird – als Bestandteil der digitalen Außenwirkung Europas.
Grenzen, Herausforderungen & Ausblick (kurz angedeutet)
Die Einführung bis 2026 ist ambitioniert. Viele Staaten haben sehr unterschiedliche nationale Systeme, gesetzliche Vorgaben und technologische Reifegrade. Interoperabilität bringt Komplexität. Datenschutz, Sicherheit, Nutzerakzeptanz und Governancemodelle sind sensible Knackpunkte.
Dennoch: Sollte die EU-eID gelingen, wäre sie ein zentrales Element digitaler Souveränität Europas – mit positiven Auswirkungen nicht nur für Verwaltung und Wirtschaft, sondern auch für Privatpersonen, die ihre digitale Identität sicher kontrollieren und nutzen können.