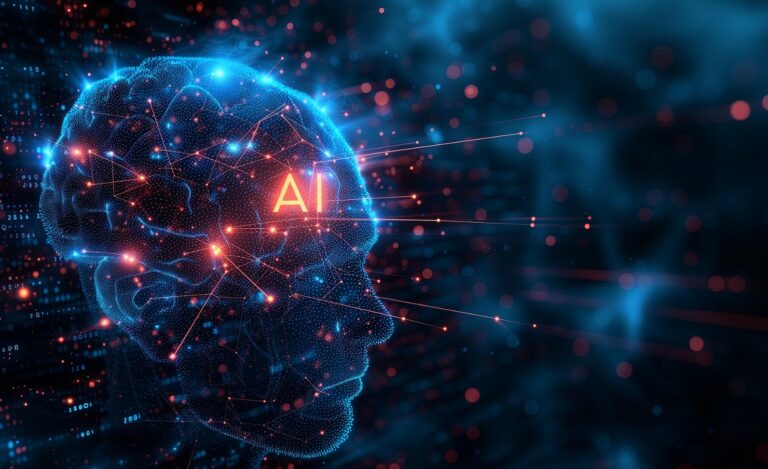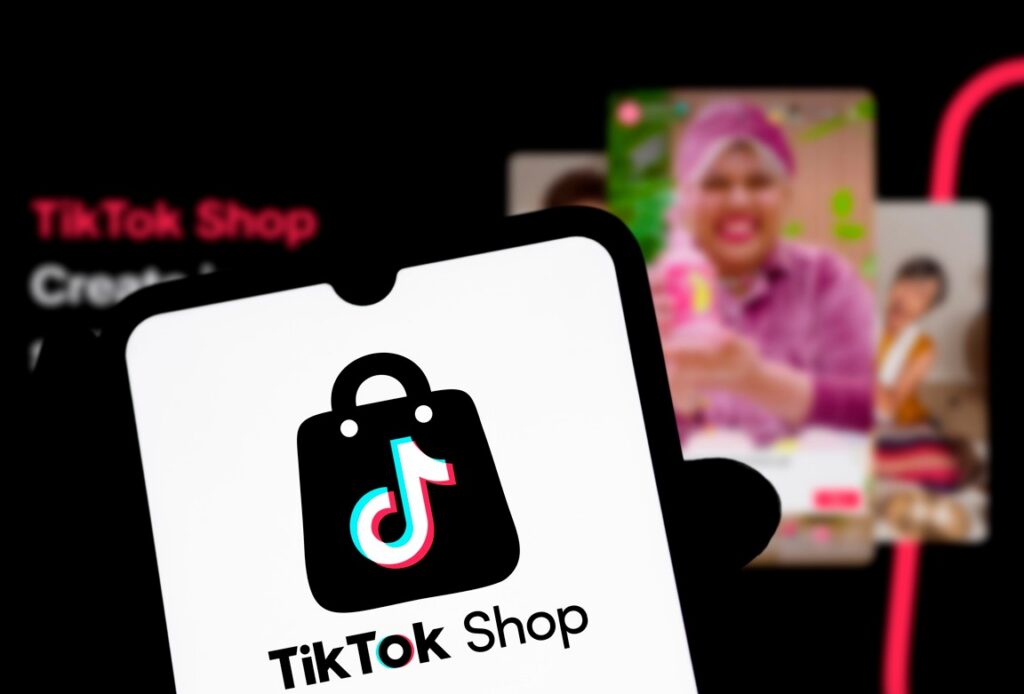Der weltweite Markt für Secondhand-Mode und Luxusgüter wächst rapide – und stellt die Modebranche vor grundlegende Veränderungen. Laut einer aktuellen Analyse von BCG und Vestiaire Collective, basierend auf einer Befragung von 7.800 Konsumenten, wächst der Wiederverkaufsmarkt jährlich um 10 % und wird bis 2030 ein Volumen von bis zu 360 Milliarden US-Dollar (rund 340 Milliarden Euro) erreichen. Damit expandiert er dreimal schneller als der traditionelle Erstverkauf.
Secondhand etabliert sich als neuer Standard
28 % der Kleidungsstücke im Kleiderschrank der Befragten stammen bereits aus zweiter Hand – bei Handtaschen liegt der Anteil sogar bei 40 %. Besonders digitale Plattformen wie Vestiaire Collective, The RealReal oder Vinted haben den Trend beschleunigt: Mehr als die Hälfte aller Käufe erfolgt über solche Online-Marktplätze.
Secondhand-Käufe haben sich als wiederkehrendes Konsumverhalten etabliert. Die wichtigsten Gründe: 80 % der Konsumenten nennen den günstigen Preis als Hauptmotivation, über die Hälfte nutzt Resale als Mittel, um Luxusmarken überhaupt erst leisten zu können. Zugleich gilt der Secondhand-Kauf für viele als Entdeckungsreise – mit Fokus auf Stil, Einzigartigkeit und Seltenheit.
Gewinnen in der Plattform-Ökonomie
Resale bietet auch Verkäufern Chancen
Auf Verkäuferseite dominieren zwei Beweggründe: der Wunsch nach „Kleiderschrank-Detox“ (66 %) sowie die Möglichkeit, über den Verkauf zusätzliches Einkommen zu generieren. 44 % der Verkäufer nutzen die Einnahmen, um neue Secondhand-Produkte zu kaufen – 18 % sogar, um sich neue Originalprodukte leisten zu können.
Amber Pepper, Marketingchefin bei Mytheresa, das mit Vestiaire Collective koopiert, beschreibt den Trend so: „Unsere Kunden wollen eine einfache und reibungslose Möglichkeit, ihre Luxusartikel weiterzuverkaufen – Nachhaltigkeit und Zirkularität spielen dabei eine wachsende Rolle.“
Resale als Wachstumstreiber für Marken
Zwei Drittel der Befragten gaben an, durch Resale erstmals mit einer Marke in Kontakt gekommen zu sein – 2022 waren es noch 59 %. Für Modemarken bedeutet das: Wiederverkauf ist nicht nur ein Nebenschauplatz, sondern ein wirksames Mittel zur Kundenbindung und Markenstärkung. Insbesondere ausverkaufte oder eingestellte Artikel sind im Secondhand-Segment begehrt – sie verlängern den Produktlebenszyklus und stärken das Markenimage.
Generation Z als Treiber der Resale-Bewegung
Besonders aktiv ist die Generation Z: In ihren Kleiderschränken stammen 32 % der Artikel aus zweiter Hand. Bei Handtaschen sind es sogar 45 %. Neben dem Preis zählen hier auch Individualität, Stil und Experimentierfreude. 80 % der Gen Z-Käufer haben über Secondhand erstmals eine Marke entdeckt – deutlich mehr als der Durchschnitt von 66 %.
Unterschiedliche Treiber in den USA und Europa
In den USA ist Resale stärker verbreitet als in Europa. Dort machen Secondhand-Artikel bereits 32 % des Kleiderschranks aus – bei Handtaschen sogar 66 %. Amerikanische Konsumenten sehen Resale stärker als Einnahmequelle und nutzen es häufiger als Teilzeitjob. Während in Europa der Fokus eher auf Ordnung und Reduktion liegt, steht in den USA der finanzielle Nutzen im Vordergrund.
Einkommensabhängige Nutzungsmuster
Unterscheidet man nach Kaufkraft, zeigen sich zwei typische Gruppen:
- Aspirational Consumers nutzen Resale als Einstieg in die Premiumwelt. Für sie ist der Wiederverkauf oft die einzige Möglichkeit, sich teure Marken zu leisten.
- Affluent Consumers nutzen Resale zur Kuratierung ihrer Garderobe – mit Fokus auf Raritäten, limitierte Editionen und hohe Wiederverkaufswerte.
Neue Geschäftsmodelle im Resale
Modemarken haben inzwischen erkannt, dass Secondhand ein strategisches Geschäftsfeld ist. Zwei dominante Modelle haben sich etabliert:
- Modell 1: Eigenbetriebene Resale-Angebote auf Markenseiten (z. B. Patagonia „Worn Wear“, Rolex „Certified Pre-Owned“, Rimowa „Recrafted“) oder über Store-in-Store-Konzepte wie bei Galeries Lafayette.
- Modell 2: Kooperationen mit spezialisierten Plattformen über „Resale-as-a-Service“-Programme. Hier entstehen Co-Branding-Angebote mit reduziertem Aufwand und erweiterten Zielgruppen.
Digitalisierung als Schlüssel: Der digitale Produktpass
Ein zentraler Hebel zur Skalierung dieser Modelle ist der digitale Produktpass (DPP). Er speichert Informationen wie Material, Herkunft, Zustand und Vorbesitzer strukturiert ab. Damit lassen sich Echtheit, Reparaturhistorie und Wertverlauf leichter nachvollziehen – zentrale Faktoren für Vertrauen und Transaktionssicherheit im Wiederverkauf.
Noch ist die Bekanntheit von DPPs gering: 65 % der Befragten hatten noch nie davon gehört. Dennoch liegt hier eine große Chance für Marken, sich als Vorreiter zu positionieren – sowohl im Sinne der Compliance (z. B. EU-Vorgaben zur Ökodesign-Verordnung) als auch im Wettbewerb um neue digitale Standards.
Vorteile für Kunden und Marken
Für Konsumenten ermöglichen DPPs:
- Sofortige Echtheitsprüfung
- One-Click-Resale mit vorgefüllten Produktdaten
- Transparente Kaufentscheidungen durch geprüfte Produktinformationen
Für Marken eröffnen sich neue Möglichkeiten zur Kundenbindung und Datennutzung:
- Zusätzliche Touchpoints bei Resale und Rebuy
- Zugang zu neuen Zielgruppen
- Rückführung von Produktdaten (Reparaturen, Nutzung etc.)
- Verbesserte Rücknahmelogistik und Schutz vor Fälschungen
- Option auf Transaktionsbeteiligung durch Lizenz- oder Royalty-Modelle
Voraussetzungen für die Umsetzung
Erforderlich sind eine enge Kooperation zwischen Marken und Resale-Plattformen sowie Investitionen in Datenmanagement, Schnittstellen zu bestehenden Systemen (POS, PIM), Datenschutz und faire Umsatzbeteiligungen. Auch die Integration in digitale Wallets für Endkunden kann zur breiten Akzeptanz beitragen.
DPPs müssen aktiv gesteuert werden – nicht als Pflichtaufgabe, sondern als strategisches Asset für Kreislaufwirtschaft, Kundenbindung und neue Umsatzpotenziale.